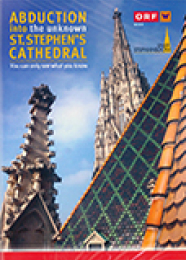Hoffnungsgedanken
Hoffnung ist in den letzten Jahren ein weltweit zunehmend strapazierter Begriff geworden. Wir hoffen auf den Sieg über den Klimawandel. Wir hoffen auf das Ende der Pandemie. Und nun hoffen wir auch noch auf den Sieg von Vernunft und Menschlichkeit in einem schrecklichen Krieg in beängstigender Nähe zu den Grenzen unserer Heimat.Wir hoffen – viel anderes können wir nicht tun. Aber was meinen wir, wenn wir von Hoffnung sprechen? In unserem heutigen, christlich geprägten Verständnis wird Hoffnung überwiegend positiv gesehen, im Sinn von Erwartung, Vertrauen und Zuversicht.
WAS VERSTEHEN WIR UNTER DEM BEGRIFF „HOFFNUNG“?
Wir wollen versuchen, die Hoffnung ein wenig zu verstehen und im Dom, als einem zentralen Ort der Hoffnung, nach den dort geborgenen Bildern der Hoffnung zu suchen. Gibt es spezielle Orte der Hoffnung im Dom? Wie können wir sie wahrnehmen? Dazu müssen wir vorher wissen, wonach wir suchen. Der Duden bringt es auf den Punkt: Hoffnung ist eine zuversichtliche innere Ausrichtung, gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreffen wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Das ist uns nicht genug. Wir fragen nach ihrer Reflexion in den Religionen, speziell im Christentum. Wir fragen nach der christlichen Hoffnung.
HOFFNUNG IM CHRISTENTUM – DER VÖLKERAPOSTEL PAULUS IM SINGERTOR
Christliche Hoffnung geht über alles menschliche Wünschen hinaus. Obwohl auf die Zukunft ausgerichtet, ist die christliche Hoffnung doch auch entscheidend auf den Augenblick der gegenwärtigen Welt bezogen und holt die Zukunft in die Gegenwart herein. Für diese besondere Hoffnung steht im Christentum vor allem der Völkerapostel Paulus. Das Neue Testament, und hier besonders die Apostelgeschichte, berichten uns ausführlich darüber.
Im Tympanonfeld des Singertores, dem südwestlichen Seiteneingang in den Dom, ist in einer wunderbaren Art und Weise der zentrale Augenblick im Leben des späteren Völkerapostels Paulus festgehalten: Sein folgenreicher Sturz vom Pferd und seine darauffolgende Bekehrung und Verwandlung vom erbitterten Gegner in den treuesten Verkünder der Botschaft Jesu bis zu seinem Tod. Paulus war offenbar ein Mann voll von Hoffnungen und Erwartungen, der, streng im jüdischen Glauben erzogen, vor bald 2000 Jahren auf die Erfüllung der Hoffnungen des Volkes Israel wartete. Paulus war treu, kompromisslos und als solcher ein erbitterter Feind der jungen Christengemeinde.
Die Apostelgeschichte, als deren Verfasser der Evangelist Lukas gilt, berichtet mehrmals von dem hellen blendenden Licht, das alle zu Boden warf, und von der Stimme, die allein Paulus verstehen konnte, weil die Botschaft nur für ihn bestimmt war. Seine Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus – etwa um 31/32 n. Chr. –, sein Sturz vom Pferd, seine Blindheit brauchten noch einige Jahre der Einordnung in eine ganz neue Richtung. Paulus weiß plötzlich: Gott rettet! Und diese Einsicht, diese Hoffnung, die allmählich zu einem sicheren Wissen wird, genügt ihm, ist für ihn der Beginn eines ganz neuen Lebensweges für immer.
Hier wird die Kraft, die Wucht der Hoffnung geradezu körperlich spürbar, man kann ahnen, was Hoffnung bewirken kann, wenn sie einen Menschen wirklich erreicht und ganz erfüllt. Eine ähnliche Hoffnung wird die Heiligen, die wir heute als solche kennen, erfüllt haben – durch die Jahrhunderte bis in unsere Gegenwart. Folgt man Paulus, dann muss die Hoffnung etwas Mächtiges, etwas Unwiderstehliches sein, dem man nicht entkommen kann. Was können wir uns also unter der Hoffnung vorstellen?
SOPHIA MIT IHREN DREI TÖCHTERN IM DOM
Der Dom kann uns dabei ein wenig helfen. Hoch oben an der Nordwand des Langhauses, gegenüber dem zweiten und dritten nördlichen Langhauspfeiler, begegnet uns die hl. Sophia mit ihren drei Töchtern Fides, Spes und Caritas – Glaube, Hoffnung und Liebe – personifiziert. Ihre Mutter Sophia, eine wohlhabende christliche Witwe aus Mailand, überließ den ganzen Reichtum ihres verstorbenen Gatten den Armen und zog mit ihren Töchtern nach Rom, wo sie, der Legende nach, gemeinsam mit diesen in der Christenverfolgung Kaiser Hadrians (117–138) das Martyrium erlitt und später zusammen mit ihnen als Heilige verehrt wurde. Die Namen der drei Töchter wurzeln in den drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe und erinnern an das Hohe Lied der Liebe (1 Kor 13, 12-13), wo es heißt: „Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei.“ Wenn auch die Historizität ihrer Leidensgeschichte nicht belegt ist, wurde diese doch in viele Sprachen übertragen, und ab dem 6. Jahrhundert ist ihre Verehrung in Rom bezeugt.
Und hier in St. Stephan begegnet uns also die bildhafte Darstellung der „kleinen Hoffnung“ als zartes junges Mädchen, in der Mitte zwischen ihren beiden älteren Schwestern, Liebe und Glaube.
CHARLES PÉGUY UND DAS GEHEIMNIS DER HOFFNUNG
Der französische Schriftsteller Charles Péguy (1873–1914) hat über diese drei Schwestern, wie er sie nannte, offenbar viel nachgedacht und in einem wunderbaren Gedicht, einem seiner drei Mysterien, 1911 die besondere Bedeutung der „zweiten göttlichen Tugend“ entdeckt – der Hoffnung, die ihren letzten Sitz im Herzen Gottes selbst hat.
Sein Zugang zum „Geheimnis der Hoffnung“ ist vielleicht weniger vordergründig dramatisch als bei Paulus.
Charles Péguy kam aus dem Sozialismus (1895 Mitglied der Soz. Partei) und kehrte als Dichter sozusagen zurück in die Tradition des einflussreichen „Renouveau catholique“, eine konservative, auch sozialkritische, aber hauptsächlich literarische, katholische Erneuerungsbewegung seiner Zeit. Und lange bevor die Hoffnung in der christlichen Befreiungstheologie sozusagen „salonfähig“ wurde, hat er auf die zentrale Stellung der „zweiten göttlichen Tugend“, der Hoffnung, hingewiesen. Wir verdanken ihm eine der schönsten Auseinandersetzungen mit der Hoffnung in Gedichtform, die er für sich als die schwierigste göttliche Tugend entdeckt hatte, deren letzten Sitz er im Herzen Gottes verortete. Dadurch wurde sie zum tragenden Grund allen christlichen und auch menschlichen Lebens.
Und Péguy zeichnet in der Folge ein poetisch-faszinierendes Bild der drei göttlichen Tugenden Glaube, Hoffnung und Liebe und stellt sie uns vor als drei Schwestern, die miteinander auf dem Weg sind: Glaube und Liebe zeichnet er als „zwei ältere Frauen, schon recht hergenommen vom Leben“, und dazwischen hüpft die kleine Hoffnung und bemüht sich, Schritt zu halten mit den beiden Älteren. Aber sie ist es, „die Kleine, die alles mit sich reißt. Denn Glaube sieht nur, was ist. Sie aber sieht, was sein wird. Und Liebe liebt nur, was ist. Sie aber liebt, was sein wird. – Glaube sieht, was ist. In Zeit und Ewigkeit. Hoffnung sieht, was sein wird. Für Zeit und Ewigkeit.“ Denn Hoffnung ist Zukunft!
Und darum mühen sich alle für die kleine Hoffnung, denn: „Alles, was man tut, das tut man den Kindern zuliebe. Und die Kinder bringen alles in Gang.“ … Denn: „Alles, was anfängt, hat eine Kraft, die sich nie mehr findet.“ – „Hoffnung, Kindheit des Herzens“ – aber: „Mit unsrer Kindheit berühren wir Jesus. Und wachsend werden wir von ihm getrennt, trennen wir uns von ihm für das ganze Leben.“ Und darum gilt trotzdem für alle, die der Kindheit entwachsen sind: „Man muss Hoffnung erwecken auf Gott … So viel Glauben an Gott muss man haben, dass man auf ihn hofft. Man muss ihm glauben, das heißt hoffen.“
HOFFNUNG – EINST UND JETZT …
Hier kommt die Frage nach dem Glauben ins Spiel. Glauben wir heute noch ernsthaft genug? Im Gegensatz zu unseren Vorfahren ist uns Menschen des 21. Jahrhunderts diese zentrale Verbindung zwischen Glaube und Hoffnung nicht mehr so bewusst. Wir wollen versuchen, Spuren vergangener Frömmigkeit zu finden und tauchen in das Spätmittelalter ein.
MITTELALTERLICHE FRÖMMIGKEIT
Der Schweizer Kultur- und Kunsthistoriker Jacob Burckhardt (1818–97) meinte einmal in Bezug auf das Mittelalter: „Es handelt sich um das Verständnis: Unser Leben ist ein Geschäft, das damalige war ein Dasein.“ Darüber lohnt es sich, nachzudenken. Der Mensch, im mittelalterlichen Verständnis, zwischen Himmel und Erde, in der Spannung zwischen „Ebenbild Gottes“ und armem Sünder angesiedelt, war sein ganzes Leben von Seelennot begleitet.Die ständig gefährdete Lebensführung, die bedrängende Sorge um das ewige Seelenheil gab dem Leben oft einen düsteren Ernst.
„Media vita in morte sumus“ – diese Feststellung Notkers von St. Gallen war allgegenwärtig. Der Tod gehörte zum Leben. Er war Angelpunkt des Lebens, von welchem alle Betrachtung ausging. In der Sorge um ihre Seligkeit ergriffen die Menschen daher bereitwillig die von der Kirche angebotenen Formen und Möglichkeiten religiösen Lebens: Gebete und Andachtsübungen, Gottesdienste an zahllosen Festund Feiertagen, aus vielfachen Anlässen entspringend, um in bestimmten Anliegen immer des Schutzes und der Fürsprache möglichst vieler Heiliger sicher zu sein. Die Regelung des irdischen Vermächtnisses vollzog sich im Einklang mit der Vorsorge auf das jenseitige Leben. Besonders klar tritt das Denken der Menschen des Mittelalters in den zahlreichen frommen Stiftungen zutage: Gläubige schenkten einen Teil ihres Besitzes an eine Kirche oder an ein Kloster, in der festen Hoffnung, damit für ihr oder ihrer Verwandten ewiges Seelenheil zu sorgen.
Auch der vertraute Umgang mit Reliquien, den Überresten der Märtyrer und Heiligen, beleuchtet die Situation der Menschen: Mitten im Leben vom Tod umgeben, in vielerlei Weise unberechenbaren Mächten ausgeliefert, zwischen Ängsten und Hoffnung hin und hergerissen, gaben die Reliquien Trost und Kraft. Da die Menschen nicht wagten, ihre Augen zu dem großen und mächtigen und fernen Gott zu erheben, erhielten die Heiligen als Mittler und Fürsprecher eine wichtige Rolle.
Kostbare Reliquien besaßen die Städte Rom und Konstantinopel. In seiner Absicht, die Krönungsstadt Aachen als dritte Hauptstadt der Christenheit zur Geltung zu bringen, bedachte Kaiser Karl der Große seine Pfalzkapelle in Aachen mit reichen Reliquienschätzen. Über den Reliquienschatz von St. Stephan, der in die zweite Hälfte des 13. Jahrhunderts zurückreichte, berichtet eine Ablassurkunde aus dem Jahr 1277, wenn sie bereits von den Heiligen spricht, die in der Pfarrkirche St. Stephan ruhen. Seinen eigentlichen Aufschwung nahm er in der Regierungszeit Herzog Rudolfs IV., der die Stephanskirche, die er zu seiner Begräbnisstätte bestimmt hatte, in wiederholten Schenkungen mit bedeutsamen Reliquien bedachte. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts – so erfahren wir – wurde der Reliquienschatz von St. Stephan nur von jenem des Kölner Domes übertroffen. Reliquien als Ankerplätze der Hoffnung.
DAS KIRCHENGEBÄUDE ALS HOFFNUNGSZEICHEN
Der Stephansdom steht seit nunmehr 875 Jahren im Herzen der Stadt. In seiner lautlosen Sprache der Zeichen und Symbole, die die Menschen unserer Zeit zunehmend nicht mehr wirklich verstehen können, versucht er unverdrossen, seine Botschaft der Hoffnung auf das Unzerstörbare, das Ewige, den Menschen dieser Stadt zu verkünden.
In seinem großen Werk über die „Entstehung der Kathedrale“ beschreibt der 1984 in Salzburg verstorbene Kunsthistoriker Hans Sedlmayr anschaulich das Gefühl der Gläubigen des Mittelalters beim Betreten der Kirche: „Die Gläubigen des 13. Jahrhunderts, die in die Kathedrale eintreten, sehen sich unmittelbar in den Himmel versetzt und nehmen, zusammen mit den Bewohnern der himmlischen Kirche, die sich im Gottesdienst mit der irdischen vereinigt und deren Chöre hier erschallen, in unmittelbar sinnlichem Genuss teil an der Seligkeit der Anschauung des Himmlischen, das sie zuallererst in der Form des überirdischen Lichtes und des überirdischen Gesanges berührt.“
Die Menschen nannten ihre Kirchen, entsprechend ihrem Lebensgefühl, Himmelsburg in der Romanik, Himmelsstadt als Sinnbild des himmlischen Jerusalems in der Gotik, himmlischer Festsaal im Barock. Und setzten ihre ganze Hoffnung darauf, durch eine entsprechende Lebensführung, in den Himmel zu kommen. Alles: Wände, Steine, Fenster, Glocken, aber auch grimmige Löwen und Greife bewachten den Eingang und sollten die Gläubigen an die Scheidung der Geister erinnern. Hoffen wir auf irgendetwas, wenn wir den Dom betrachten?
CHRISTUS IM RIESENTOR
Beim Eintritt in den Kirchenraum ließen die Besucher bereits hoffnungsvoll die dämonische Welt hinter sich, überschritten die Schwelle und waren gerettet. Denn über der Schwelle im Zentrum des Riesentores thront der Hausherr persönlich, Jesus Christus, begleitet von Engeln und Aposteln. Er grüßt und segnet (immer noch) die Eintretenden – und früher war es wichtig, ihm beim Eintritt seine Ehrerbietung zu erweisen. Und alle, welchen der Eintritt in den Kirchenraum gelungen war, fanden sich in einer Welt voller Wunder wieder, hier war nichts mehr ohne Bedeutung. Sie haben vielleicht nicht alles verstanden, was sich ihren Augen darbot, für manches brauchten sie Symbole als Hilfsmittel: Wegweiser in die Tiefe – das Wort, aus dem Griechischen kommend, „symballo“ bedeutet das Zusammenfügen zweier getrennter Teile zu einem Ganzen. Mit den Augen des Glaubens betrachtet, ist die ganze Welt ein hoffnungsvolles Symbol. Leider ist uns Menschen von heute das Wissen um die Bedeutung der Symbole abhandengekommen.
Heute beachtet fast niemand mehr den segnenden Hausherrn in der Mandorla des Riesentores, nicht aus Bosheit, sondern aus Unwissenheit. „Man sieht nur, was man weiß“ lautet ein bewährtes Sprichwort. Und darum nehmen viele nichts wirklich Entscheidendes mit nach Hause, weil keine Begegnung geschehen ist. Die einzige Möglichkeit, hier gegenzusteuern, ist, mit den Kindern wieder neu zu beginnen.
GNADENBILDER
Auf die Hilfe der Muttergottes konnte man sich aber immer schon verlassen, und das ist wohl auch heute noch so. Sie war den Menschen wohl näher als der in Herrscherpose im Riesentor thronende Christus. Und auch heute finden die Menschen die drei Orte, wo man die Gottesmutter treffen kann:
Der Dom birgt drei marianische Gnadenbilder, die Hoffnung auf Hilfe nicht nur versprachen, sondern oft auch einlösten: die Dienstbotenmuttergottes, aus dem ersten Drittel des 14. Jahrhunderts, am Eingang zur südlichen Chorhalle, noch aus der Zeit des Chorbaues. Das sogenannte „Alte Gnadenbild Maria in der Sonne“, das 1693 und das neue Gnadenbild „Maria Pocs“, welches 1697 in den Dom eingezogen ist. Und immer noch finden sich dort Menschen ein, die ganz bewusst ihre Hoffnung auf die Mutter des Herrn setzen. Das war schon immer so. Als ein Beispiel für viele soll hier eine Bitte stehen, die Erhörung fand: die Rettung und Heilung eines Bauersmannes, Peter Schneider mit Namen, vor der Amputation seines Beines. Hier heißt es wörtlich:
„Peter Schneider, ein Bauers-Mann, hat nach 4 Wochen lang gelittenem Rothlauff den Fuss genetzet, welches ihme dermassen misslungen, dass erfahrne Barbierer dafürgehalten, es möge ihm ohne Abnehmung des Fusses nicht geholffen werden: worab er sich entsetzte und dann sein eintzige Hoffnung auf unser Pötschischen Wunder Arztin setzte, durch welche er auch bald geheylet. Anno 1699.“ Dokumentiert und nachzulesen in dem im Jahr 1739 abgefassten Büchlein: „Erneuert und vermehrter Gnaden-Brunn, in dem wunderthätigen Bild der weinenden Mutter Gottes von Pötsch, welches in Original in der Wiennerischen Metropolitankirchen verehret wird.“
DIE HEILIGEN DES DOMES
Der Stephansdom ist, nach dem Willen Herzog Rudolfs IV., seit dem Jahr 1365 auch ein „Allerheiligendom“. Der Einzug der Heiligen in den Dom erfolgte sozusagen nach und nach: in der Zeit des Chorbaues, nach 1340, nach der Vollendung des Langhauses in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Nur wenige neue Heilige kamen nach der Reformation. Erst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hielten – vornehmlich heilige Frauen – Einzug in den Dom. Ihre nicht zu übersehende Gegenwart soll ein starkes Zeichen der Hoffnung für alle Frauen in unserer Kirche sein.
Die Heiligen, Männer wie Frauen, hatten allesamt ein nicht immer leichtes, dafür aber ein geglücktes Leben vorzuweisen. Die deutsche Schriftstellerin jüdischen Glaubens, Hilde Domin (+2006), hat in einem Gedicht, sich einfühlsam in sie hineindenkend, ihre Situation hoch oben auf ihren Podesten an den Langhauspfeilern beschrieben: ihre Müdigkeit, immer nur Bitten anzuhören und zu wenig Glauben und Vertrauen zu spüren, immer wieder Bitten zu hören „um das gestern Gewährte … sie sind müde, Vikare des Unmöglichen auf Erden zu sein …“ Und dann folgert sie:
„Sie (die Heiligen) sind müde, aber sie bleiben, der Kinder wegen. Sie behalten den goldenen Reif auf dem Kopf, den goldenen Reif, der wichtiger ist als die Milch. Denn wir essen Brot, aber wir leben vom Glanz. Wenn die Lichter angehn vor dem Gold, zerlaufen die Herzen der Kinder und beginnen zu leuchten vor den Altären, damit es eine Tür gibt, eine schwere Tür für Kinderhände, hinter denen das Wunder angefasst werden kann.“ „Mit unserer Kindheit berühren wir Jesus. Und wachsend werden wir von ihm getrennt, trennen wir uns von ihm für das ganze Leben.“ Sagt Charles Péguy über die Kinder.
DIE KINDER IM DOM
Wie können wir wieder Hoffnung lernen? „Hoffnung, Kindheit des Herzens“, sagt Péguy.„Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder…“, sagt Jesus. Darum ist unser wichtigster Beitrag zu einer neuen Hoffnung für die Zukunft in schwierigen Zeiten die Sorge um die Kinder, dass aus ihnen gläubige, liebevolle und immer hoffende Menschen werden. Das wird uns zugleich helfen, die in unserer eigenen Kindheit gekannte Hoffnung in jedem von uns wiederzufinden!
Dr. Annemarie Fenzl, Kardinal-König-Archiv